Wozu brauchen wir noch Parteien? Und geht Demokratie in Zeiten sozialer Medien nicht auch moderner? Der Bericht mit den Video-Mitschnitten unserer Tagung zur "Zukunft der Parteiendemokratie".
- Prekäre Demokratie. Eine Eröffnung
- Internet kills the Video Star: Politisierung in Zeiten zerfasernder Öffentlichkeit
- Parteien! Was ist ihr Problem? Streitgespräch über eine Rollenbestimmung
- Millionen schauen zu: Demokratie im TV-Serienformat
1. Prekäre Demokratie. Eine Eröffnung
Die Debatte beginnt mit einer streitbaren und zugespitzten Diagnose, die der Philosoph und Soziologe Oliver Marchart formuliert:
Politische Betätigung ist so was wie ein Freizeitsport einer wohl situierten Mitte geworden, während die sogenannten Unterschichten nicht mal länger zur Wahl gehen, da sie die Hoffnung aufgegeben haben, ein Wechsel der Parteien an der Regierung könnte etwas an ihrer misslichen Lage ändern.
Marchart extrahiert diese Beschreibung aus einem Spiegel-Artikel zur Bremen-Wahl im Mai 2015, bei der nur noch jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben hatte. Der Autor sah als Mit-Ursache eine „Entsaftung der Politik“ in der Ära Merkel und sprach von „prekärer Demokratie“, weil vor allem die „Armen und Abgehängten“ nicht mehr wählen gingen. Auch Marchart sieht das Problem, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr repräsentiert wird oder sich nicht repräsentieren lassen will. Die Diagnose geht ihm aber nicht tief genug. Seine Doppelthese lautet:
- Die Demokratie ist nicht nur heute zu einer prekären Angelegenheit geworden, sondern Demokratie ist strukturell prekär.
- Die Prekarisierung des Sozialen stellt eine Gefahr für die Demokratie dar.
Zur Begründung verweist Marchart auf den Philosophen Lefort, der die Macht als leeren Ort beschrieb, der durch Wahlen immer wieder neu besetzt werden muss. Der Sinn von Wahlen sei also vor allem symbolischer Natur, und im Wahlergebnis drücke sich kein einheitlicher Volkswille aus, sondern nur ein Zahlenverhältnis, so Marchart. Das führe zu Frustrationen beim Wähler. Erwartungen nach „saftiger Politik“ würden durch die langwierigen Prozesse der Meinungsbildung enttäuscht. Für ihn folgt daraus, dass das „Unbehagen an der Demokratie“ strukturell bedingt ist.
Darüber hinaus gebe es durch die zunehmende Prekarisierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen einen „Frustrationsüberschuss“, der sich nicht nur in Wahlabstinenz, sondern auch in weltweiten Protesten wie der Occupy-Bewegung 2011 niederschlage. Marchart betont, dass für ihn Prekarisierung weit über das „abgehängte Prekariat“ hinausgeht: Er sieht eine Verunsicherung bei der Mehrheit der Bevölkerung aus Angst vor sozialem Abstieg und damit einen „breit gefächerten Prekarisierungsstrom“. Soziale Unsicherheit aber lasse nach Sicherheiten in der Politik suchen, die die Demokratie nicht biete. Marchart folgert:
Politische Verunsicherung braucht soziale Absicherung, sonst kann Demokratie nicht funktionieren.
Schon deshalb müsse man der Prekarisierung entgegenwirken. Die Parteien in ihrer jetzigen Form befänden sich aber wie die Gesellschaft in einer Krise und seien dysfunktional, behauptet der politische Theoretiker. Er hofft auf Experimente, wie er sie bei neuen linken Parteien in Europa sieht, etwa der griechischen Syriza, die er als basisdemokratisch organisierte, populistische Partei mit starker Führungspersönlichkeit charakterisiert. Nur durch eine Kombination aus scheinbaren Widersprüchen kann Neues entstehen, gibt Marchart zu bedenken. Er appelliert deshalb an die etablierten Parteien, Mut zur Veränderung zu zeigen, um zukunftsfähig zu bleiben: "Was nottut, wäre ein emanzipatorischer Experimentalismus sowohl auf programmatischer wie organisatorischer Ebene."
Zwischenruf: Viele wollen, dürfen aber nicht wählen
Die Autorin und politische Kolumnistin Mely Kiyak meldet sich zu Wort und erinnert an jene Menschen, die schon viele Jahre in Deutschland leben, aber kein Wahlrecht haben. Das betreffe etwa 4,5 Millionen, deren Stimme nicht gehört werde, weil sie keinen deutschen Pass haben:
Wir beklagen uns über jene, die ein Wahlrecht haben, es aber nicht in Anspruch nehmen, und vergessen dabei die große Gruppe von Menschen, die in diesem Land seit Jahrzehnten nicht wählen können. Die Parteienlandschaft, vielleicht auch die politische Kultur, würde höchstwahrscheinlich anders aussehen, wenn diese Leute am Meinungsbildungsprozess beteiligt wären.
Kiyak erscheint das als großes Defizit, über das zu wenig gesprochen wird in der Diskussion über Parteien und Demokratie.
Die Soziologin Jasmin Siri forscht empirisch zu Parteien. Sie konkretisiert die Diagnose von Oliver Marchart: Kritik an den Parteien in Deutschland gebe es, seit es Parteien gibt; sie habe sich in den letzten Jahren aber tatsächlich verstärkt. Die Veränderungen, meint die Wissenschaftlerin, haben auch mit neuen Öffentlichkeiten durch das Internet zu tun. Es zeige sich jetzt deutlich, dass es viel mehr als nur eine repräsentative Öffentlichkeit gibt: "In diesen pluralisierten, ausdifferenzierten Öffentlichkeiten wird es offenbar schwieriger, sich zu verständigen und sich als ein Volk zu verstehen."
Die Situation begünstige Gruppen, die einfache Antworten bieten, gerade auch rechtspopulistische Organisationen. Deren politische Strategien seien „Politiken der Angst“. Siri fragt Marchart kritisch, ob nach seinen Maßstäben nicht auch Pegida eine neue „experimentelle“ Organisationsform darstelle. Die Bewegung mache Menschen sichtbar, die vom politischen und gesellschaftlichen Establishment vorher so nicht wahrgenommen wurden. Es sei wichtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dafür erntet Siri später in der Diskussion heftigen Widerspruch; auch die Argumente von Oliver Marchart werden aus dem Publikum hinterfragt.
Die Kolumnistin Mely Kiyak betont eine starke Dynamik zwischen Öffentlichkeit und Politik: Sie erlebe eine wahre Flut an politischen Meinungen, vor allem in den Kommentarspalten der Online-Medien. Sehr viele Leute wollten sich äußern und seien interessiert – vielleicht weniger an Parteien und Wahlen, aber an politischen Diskussionen. Bei den Politikerinnen und Politikern selbst nimmt Kiyak häufig Verunsicherung wahr. Ihr fällt auf, dass sie als Kommentatorin rasch zur Expertin hochstilisiert wird, deren Meinung Gewicht hat.
Kiyak setzt auch den Schlusspunkt an diesem Abend: Ob eine Partei vital und erfolgreich ist, hänge nicht von ihrer Organisationsstruktur ab:
Ich glaube, dass der Erfolg einer Partei immer noch über die Themen funktioniert. Dass die Leute das Gefühl haben, dass das, was jetzt aktuell ist, aufgegriffen wird von der Partei, mit der sie noch am ehesten sympathisieren. Und dass sie vertreten wird durch das Personal, von dem man denkt, dass es diese Inhalte am authentischsten vertritt.
2. Internet kills the Video Star: Politisierung in Zeiten zerfasernder Öffentlichkeit
Das Internet hat den Raum der politischen Öffentlichkeit enorm erweitert. Die Menge an Online-Petitionen, Blogs, Wikis, Interessengruppen in sozialen Netzwerken lässt bei vielen Beobachtern den Eindruck einer Zerfaserung entstehen, so Moderator Jan Engelmann Das fordert die Parteien heraus:
Die digitalen Wege der Kommunikation und Zusammenarbeit setzen das politische System gehörig unter Druck. Vor allem deshalb, weil sie zu einer extremen Beschleunigung des politischen Agierens und Reagierens geführt haben.
Liegt darin eine Gefahr für die repräsentative Demokratie? Der Internet-Berater und Blogger Christoph Kappes gibt auf diese Frage von Engelmann erstmal keine Antwort. Ihm geht es in seinem Vortrag um eine Beschreibung der veränderten Öffentlichkeit und ihrer Chancen.
Kappes haderte zunächst mit dem Titel „Internet kills the Video Star“. Der müsse korrigiert werden angesichts des Fernsehkonsums auch der jungen Generation und der Beliebtheit des Videokanals Youtube. Auch mit dem Begriff „Zerfaserung der Öffentlichkeit“ hat der studierte Jurist Schwierigkeiten. Er weckt bei ihm die medizinische Assoziation, „als sind wir alle ein großer Volksmuskel, der gewissermaßen zerfasert“. Genauso lehnt er die Bezeichnung „Fragmentierung“ ab. Beide Begriffe hätten mit Zerstörung von Einheit zu tun, die es seiner Meinung nach nicht gegeben hat und auch nicht geben wird. Kappes spricht auch von Diversität oder von „grüner Vielfalt“. Und führt mit klugen Gedanken aus, warum er diese Entwicklung positiv findet.
Öffentlichkeit als dynamisches System von Interaktionen
Öffentlichkeit wird durch Beziehungen konstruiert, die nicht (mehr) an Massenmedien gekoppelt sind, sagt Kappes. Sie entsteht durch Interaktionen, die ständig in Bewegung sind und eine Synthese von politischen Meinungen herstellen. Die Zahl der Akteure hat sich im Vergleich zur früheren, durch klassische Medien vermittelten Öffentlichkeit verhundertfacht, schätzt er. Zu den knapp 100.000 Journalistinnen und Journalisten in Deutschland kommen Millionen Internetnutzer, die aktiv an Diskussionen teilnehmen:
Die Politik hat nun mehr Adressen, mit denen sie die Gesellschaft erreichen und beobachten kann. Das ist ein Vorteil, der die Leistungsfähigkeit der Politik erhöht.
Die Trennung zwischen massenmedial und nicht-massenmedial will er aufheben: Medien und Internet bilden die neue Öffentlichkeit. Sein vor Jahren eingeführtes Bild von „verschachtelten Räumen mit Straßen und Gassen“ widerruft Kappes und spricht stattdessen von einer „atmenden Galaxie“. Seine These:
Die neue Öffentlichkeit ist nicht einfach nur größer, sondern sie ist inklusiver, sie bezieht mehr Leute ein, und sie wird so hergestellt, dass sie kommunikativ leistungsfähiger ist. Das heißt, sie kann mehr Sinn herstellen.
Mit Sinn meint Kappes, Handlungen in ihrer Abfolge und Absicht besser erkennen zu können. Der Internet-Berater räumt ein, dass damit eine Überforderung verbunden sein kann. Er kennt diesen Effekt selbst und hat ihn auch bei Politikern beobachtet. Aber er will ihn nicht beurteilen, sondern schlicht feststellen: "Wir müssen jetzt damit klarkommen, mit diesem Überschuss an Sinnproduktion. Also damit umzugehen lernen."
Die Gefahr von Desinformation, In-Transparenz, Lobbyismus und die Unsicherheit über die Verlässlichkeit von Informationen müsse man im Blick behalten. Mehr Sinnangebote, aber ohne Verlässlichkeit? Das Fragezeichen lässt er stehen. Was ihm besonders wichtig ist, fasst Kappes zum Schluss noch einmal zusammen: Die Internet-Öffentlichkeit macht Konflikte und Themen sichtbar, die vorher so nicht sichtbar waren. Das ist für ihn ein Fortschritt.
Erfahrungen einer unabhängigen Online-Plattform für politische Debatten

Wie mühsam es ist, einen unabhängigen politischen Diskurs im Internet zu etablieren, erzählt Linnea Riensberg vom Debattenportal Publixsphere. Das gemeinnützige Projekt ist der Versuch, vor allem junge Erwachsene über Parteigrenzen hinweg zu motivieren, ihre Meinungen auszutauschen.
Man muss ganz viel experimentieren, aber in bestimmten Situationen haben wir das schon sehr gut hinbekommen, auf einer qualitativ hochwertigen Ebene Diskurse herzustellen.
Allerdings sei den Machern immer klarer geworden, dass das nicht nur online geht. Publixphere setzt deshalb auch auf Veranstaltungen und Partizipation vor Ort. Eine Schwierigkeit ist auch die Finanzierung. Linnea Riensberg fragt sich inzwischen, inwieweit Überparteilichkeit wirklich wichtig ist, oder ob es nicht wichtiger ist, klare Positionen herzustellen und darüber einen offenen Diskurs zu führen. Das funktioniere immer noch: Auf klare Meinungen gibt es Reaktionen.
Die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Sandra Mamitzsch kommt in die Runde mit frischen Eindrücken vom Kinofilm „Democracy“ über den Grünen- Abgeordneten Jan Philipp Albrecht, der im Europa-Parlament zuständig für die Überarbeitung der Datenschutzrichtlinien ist. Der Film könne helfen, junge Leute für die komplizierte EU-Politik zu interessieren, glaubt sie. Auf Nachfrage aus dem Publikum, wie es besser gelingen könnte, die schnelle Öffentlichkeit und die langsame Politsphäre zusammenzubringen, empfiehlt Mamitzsch, beide Geschwindigkeiten sollten gepflegt werden. Mit Linnea Riensberg ist sie sich einig, dass die Gespräche im Hinterzimmer für die Parteien nach wie vor wichtig sind. Gleichzeitig müssten Politikerinnen und Politiker noch viel stärker befähigt werden, nicht nur in Bürgersprechstunden, sondern auch online direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren – sei es über Blogs, soziale Netzwerke oder Plattformen wie abgeordnetenwatch.de.
3. Parteien! Was ist ihr Problem?
In vier Schritten geht es hier um eine Rollenbestimmung, beginnend mit dem Blick von außen: Was wünschen sich Aktive in Projekten und Nichtregierungsorganisationen? Herausforderungen und Leistungen der Parteien werden diskutiert und es gibt konkrete Reformvorschläge.
I. Parteien? Ohne mich!
Die vielen Engagierten, die außerhalb von Parteien ihre politischen Anliegen vorantreiben, bestimmen den Prozess der öffentlichen Meinungsbildung entscheidend mit. Deshalb tun die Parteien gut daran, auf diese Stimmen zu hören, sagt Demokratie-Referentin Anne Ulrich von der Heinrich-Böll-Stiftung:
Parteien können eine Projekte-Szene in keiner Weise ersetzen. Es ist für beide Seiten essentiell zu verstehen, wie es um die Arbeitsteiligkeit in einer pluralistischen Demokratie bestellt ist.
Anne Ulrich hofft auf Anregungen für eine bessere Kooperation zwischen Parteien und Projekten. Stellvertretend für die Vielfalt der Szene hat sie zwei Akteure eingeladen: den Münchner Journalisten Stefan Hanitzsch, Mitgründer des Internet-Senders stoersender.tv, und Mirco Beisheim von der Hamburger Initiative KEBAP - KulturEnergieBunkerAltonaProjekt. Hanitzsch beginnt mit einem unerwarteten Kompliment:
Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, um die Parteiendemokratie zu retten. Das ist alles andere als selbstverständlich - die meisten Menschen wissen nicht mal, was das ist, das ist zumindest meine Erfahrung.
Dem Journalisten und SPD-Mitglied liegen die Parteien offensichtlich am Herzen, auch wenn er sie in seinem satirischen Sender gern durch den Kakao zieht. Stoersender.tv hat er 2012 zusammen mit dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt gegründet, finanziert durch Crowdfunding. Die Idee dahinter ist laut Hanitzsch, ein unabhängiges, werbefreies Programm zu machen, das nicht nur Parteien und Bundestag kritisch hinterfragt, sondern auch Zwischentöne ins TV bringen will. In den Reaktionen der Zuschauer finden sich teils drastische Kommentare über Politiker und Parteien, erzählt Hanitzsch. Viele glaubten, gewählte Parteien seien korrupt und an allem Schlechten schuld. Die Ablehnung der Demokratie sei in Teilen der Bevölkerung groß, das müssten die Parteien mindestens berücksichtigen, mahnt er.
Spannungsverhältnis zwischen Bürgern und Politik
 Der energiepolitische Aktivist Mirco Beisheim berichtet von den Spannungen zwischen Umweltschützern und den Hamburger Grünen in den vergangenen Jahren. Viele Aktive hätten sich abgewandt, als die mitregierenden Grünen das Kohlekraftwerk Moorburg genehmigten, obwohl sie sich im Wahlkampf dagegen positioniert hatten. Es folgte der nächste Konflikt um eine Fernwärmeleitung, deren Bau die NGOs per Gerichtsverfahren stoppten:
Der energiepolitische Aktivist Mirco Beisheim berichtet von den Spannungen zwischen Umweltschützern und den Hamburger Grünen in den vergangenen Jahren. Viele Aktive hätten sich abgewandt, als die mitregierenden Grünen das Kohlekraftwerk Moorburg genehmigten, obwohl sie sich im Wahlkampf dagegen positioniert hatten. Es folgte der nächste Konflikt um eine Fernwärmeleitung, deren Bau die NGOs per Gerichtsverfahren stoppten:
Gerade aus diesem Verfahren, in dem sich Umweltschützer und grün geführte Verwaltung gegenüberstanden, ist ein tiefer Vertrauensbruch entstanden.
Anders lief es bei der Volksinitiative „Unser Hamburg - Unser Netz“. Hier haben NGOs und die die Parteien Grüne, Linke und Piraten an einem Strang gezogen und die Rekommunalisierung des Stromnetzes durchgesetzt. Auch bei seinem aktuellen Projekt KEBAP e.V. arbeiten die Ehrenamtlichen mit Parteien und der Verwaltung zusammen. Da entsteht wieder Vertrauen, meint Beisheim:
Diese Entwicklung in den letzten Jahren in der Hamburger Energiepolitik war aber nur möglich, weil sich Leute gesagt haben: Wir machen jetzt einfach, wir warten nicht mehr, dass in der Parteipolitik die Wege eingeschlagen werden, sondern wir erzwingen das jetzt mit dem Druck der Straße.
Beisheim wünscht sich gerade auch von den Grünen mehr Transparenz und Mut zu Gesprächen mit den NGOs. Während die Parteien ganz selbstverständlich mit Wirtschaftsvertretern oder Verbänden sprechen, hat er oft das Gefühl, es gebe gegenüber Bürgerinitiativen eine gewisse Scheu. Für ihn gilt:
Wir haben die parlamentarische Demokratie, wir haben Parteiendemokratie und es gibt die direkte Demokratie. Eigentlich gehört das ja alles zusammen.
Im Moment hat Beisheim aber den Eindruck, dass die direkte Demokratie etwa durch Volksentscheide oft schneller ist und die Parteiendemokratie hinterherhinkt.
II. Was fordert Parteien heute heraus?
Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky gibt vier forsche Thesen zur Krise der Parteien vor:
1. Parteien sind nicht in einer Funktionskrise, sondern in einer Akzeptanzkrise
Funktionen wie die Steuerung der staatlichen Willensbildung, Legitimation des politischen Gemeinwesens und Ausbildung von Führungskräften erfüllen die Parteien immer noch sehr gut, meint Lewandowsky. Aber: Sie werden weniger akzeptiert. Das größte Problem sieht er in der Repräsentation sozialer Kräfte, die nicht mehr so gut funktioniert wie zu Gründungszeiten der großen Parteien.
2. Parteien sind sozial selektiv
Lewandowsky nennt dazu einige Fakten, die für ihn dieses Problem besonders gut illustrieren: Der Frauenanteil in Parteien ist signifikant geringer als in der Bevölkerung. Ältere, Akademiker und Besserverdiener sind überrepräsentiert; diejenigen, die nach eigener Einschätzung zur Unterschicht gehören, unterrepräsentiert.
3. Parteien sind als Organisationen unattraktiv
Hier führt der junge Politikwissenschaftler zuvorderst den großen Zeitaufwand an, den die Mitarbeit in Parteien erfordere. Es dauere zu lange, bis man etwas erreiche. Das sei mit Familie und Beruf schlecht vereinbar. Auch die Überalterung wirke gerade für junge potentielle Mitglieder abschreckend. Die Parteien sehen diese Probleme, aber sie ziehen nicht die richtigen Schlüsse, meint Lewandowsky:
Die Parteien haben in den letzten Jahren vor allem so reagiert, dass sie sich dem Akzeptanzproblem im Grunde genommen ergeben haben und versucht haben, weniger Partei zu sein. Das lief dann unter dem Begriff der Öffnung.
Geschlechterquoten, Urabstimmungen, Öffnung der Parteistrukturen auch für Nichtmitglieder seien zum Beispiel typische Reformmaßnahmen gewesen, zählt Lewandowsky auf. Er zitiert eine Studie, die er als Mitautor in Nordrhein-Westfalen durchgeführt hat. Darin sei quer durch alle Schichten einhellig der Wunsch nach mehr Beteiligung für Parteimitglieder geäußert worden, nicht nach stärkerer Einbindung der Nichtmitglieder. Das lässt ihn folgern:
4. Parteien sollen nicht inklusiver, sondern exklusiver werden
Lewandosky meint damit, dass es attraktiver werden müsste, einer Partei beizutreten – durch mehr politische Mitwirkungsrechte ausschließlich für Mitglieder, mehr innerparteilichen Wettbewerb, mehr Mitarbeit am Parteiprogramm. Er rät außerdem, das interne Regelwerk zu entschlacken und empfiehlt dringend, das Ortsvereins-Prinzip aufzugeben und andere Beteiligungsmöglichkeiten, auch online, zu entwickeln.

Mehr Inhalte, mehr Streit über Grundsatzfragen
Die Journalistin Bettina Gaus, Publizist Albrecht von Lucke und Moderator Tobias Dürr diskutieren anschließend leidenschaftlich über die Thesen von Lewandowsky und ihre Sicht auf die Parteienkrise. Gaus sieht darin durchaus ein Problem, auch wenn die Parteien formal funktionieren. Bezogen auf die aktuellen politischen Entwicklungen ärgert sie sich über Sprüche aus allen Parteien in den letzten Wochen, jetzt müsse Schluss sein mit dem Parteienstreit, es müsse gehandelt werden.
Wenn die Parteien selbst so tun, als handele es sich um eine Form von schlechtem Benehmen, wenn sie Meinungsverschiedenheiten austragen, selbst innerhalb einer Koalition, dann wird das die Akzeptanz nicht vergrößern.
Denn die Parteien hätten eben auch die Funktion, die unterschiedlichen Ansichten zu vertreten, die es in der Bevölkerung gibt. Insofern beklagt Gaus ebenso, dass sich die Parteien inhaltlich immer mehr angleichen. Auch Albrecht von Lucke macht die Akzeptanz-Erosion große Sorgen. Wenn auf der Straße „Lügenpresse“ und „Volksverräter“ gerufen werde, eine Politikerin fast umgebracht worden sei, müsse man selbstkritisch fragen:
Haben wir nicht auch als Parteien, haben wir als Stiftungen, haben wir auch als Parteienforscher nicht ein Stück weit zur Entpolitisierung der Parteien beigetragen?
Von Lucke gibt Lewandowksy recht, dass die Parteien attraktiver werden müssen, auch exklusiver – aber durch Inhalte. Alle hätten es in den letzten Jahren versäumt, leidenschaftlich über politische Grundsatzfragen zu streiten. Auch die Grünen, meint von Lucke: Sie sollten die Frage der Zeit diskutieren, wie eine nachhaltige, gerechte Welt aussehen muss, damit Ursachen für Flucht und Vertreibung bekämpft werden. Das könnte eine Repolitisierung viel eher bewirken als eine Debatte über Formalien wie die Vereinbarkeit von Politik und Beruf, Organisationsstruktur oder Marketing.
Die Meinungsbildung, die im Grundgesetz vorgesehen ist, die politische Auseinandersetzung, findet seit langer Zeit nicht mehr statt in der Schärfe. Und das ist ein großes Versagen und der Kern des Problems.
III. Was haben Parteien zu leisten?
Für Peter Siller, Leiter der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung, ist eine Erneuerung der Parteiendemokratie essentiell. Er beklagt, dass fast alle Debatten, die er kennt, extreme Krisenanalysen und wenig zukunftsgerichtet sind. Daraus wachse keine Energie für die Erneuerung. Das gelte auch für die politikwissenschaftlichen Diskurse. Es mache keinen Sinn, über Funktionalität zu sprechen, wenn man die grundsätzliche Hoffnung nicht teilt, dass in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um unterschiedliche Auffassungen vom Gemeinwohl die Kraft der Demokratie liegt. Parteien sollten nicht moderieren, sondern diskursiv und streitbar Inhalte gestalten, ist Siller überzeugt. Konkret plädiert er dafür, das Bild des Berufspolitikers zu überdenken, der immer unter dem Druck der Wiederwahl steht.
Parteiarbeit in der Praxis
Der SPD-Politiker Thomas Kralinski berichtet über praktische Erfahrungen aus Brandenburg. Seine Partei hat dort gut 6000 Mitglieder, es waren mal 7000. Für eine Volkspartei sei das extrem wenig; damit könne die regierende SPD auch nicht beanspruchen, 2,5 Millionen Einwohner zu repräsentieren. Um trotzdem Probleme aus der Breite der Gesellschaft zu erfassen, bemühe sich die Partei um eine gute Kommunikation mit der Bevölkerung. Außerdem strecke die Brandenburger SPD über Vereine und Institutionen ihre Fühler aus. Auf kommunaler Ebene arbeiten die Sozialdemokraten oft mit parteilosen Kandidaten zusammen, so Kralinski. Er glaubt, dass es seiner Partei ganz gut gelingt, unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bekommen. Schon deshalb, weil in der Landtagsfraktion fast nur direkt gewählte Abgeordnete sitzen, die aus ihren Wahlkreisen Themen und Stimmungen mitbringen. Da wird auch diskutiert und gestritten, meint der Politiker.
Ich finde schon, dass Parteien, dass auch Parlamente viel reflexiver sind, als das gemeinhin angenommen wird.
Kralinski regt an, die Rolle der Fraktionen stärker zu beachten, wenn es um die Bündelung von Interessen und die inhaltliche Weiterentwicklung der Parteien geht.
IV. Parteireform als Alltagsgeschäft
Mehr Interaktion, weniger Negativanalyse und mehr gute Ideen, die zur Mitarbeit ermutigen – das wünscht sich Hanno Burmester nicht nur von Parteien, sondern auch von Tagungen. Burmester ist Leiter einer Studie, die im vergangenen Jahr Zukunftsimpulse für politische Parteien zusammengestellt hat (www.parteireform.org).
Wie kann Parteiarbeit so aussehen, dass sie sichtbar und erlebbar wird für mich als Engagierten, aber auch für die Umwelt, mit der ich zu tun habe?
Er fragt weiter, ob Parteien nicht so viel wie möglich mit Nicht-Mitgliedern kommunizieren müssten – und stellt sich damit gegen die Exlusiv-These von Marcel Lewandowsky.
Der Organisationsberater präsentiert noch viele andere Anregungen: mehr Aktionen als Gremien, eine Kultur der Neugier und Offenheit, eine bessere Führungs- und Mitmachkultur. Parteien sollten erkennbar machen, für welche Vision sie stehen. Und Burmester rät, die Mitglieder auf allen Ebenen zu qualifizieren.
4. Millionen schauen zu: Demokratie im Serienformat
Zwei international erfolgreiche Fernsehserien über Politik und Macht stehen im Mittelpunkt: „Borgen“ aus Dänemark und „House of Cards“ aus den USA.
Lange galt das Fernsehen selbst als Medium der Demokratie, daran erinnert Moderator Arnd Pollmann: Politik konnte breiter wahrgenommen werden, das öffentlich-rechtliche Fernsehen sollte die demokratische Kultur befördern. In den heute populären Drama-Serien werde Demokratie als Unterhaltung geboten.
Ines Kappert vom Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterforschung der Heinrich-Böll-Stiftung hat sich intensiv mit „Borgen“ beschäftigt. Die Serie, 2012 erstmals im öffentlich-rechtlichen dänischen Fernsehen gezeigt, handelt von Aufstieg, Fall und Wiederaufstieg der Politikerin Birgitte Nyborg. Kappert nennt drei Grundzüge des Erzählens in modernen TV-Serien:
- Die Figuren sind ambivalent und werden differenziert gezeichnet. Daraus bezieht die Handlung ihre Spannung.
- Das Prinzip des „Cliffhangers“ funktioniert jetzt anders, weil viele Zuschauer mehrere Folgen hintereinander sehen, per Stream oder auf DVD.
- Die Erzählweise ist realitätsnah und detailliert. Es werden große Erzählbögen gespannt.
Ines Kappert sieht in der Figur der Birgitte Nyborg ein weibliches Gegenbild zu dem des männlichen Berufspolitikers, der zynisch und berechnend handelt. Die Heldin von „Borgen“ reagiere eigenständig und unkonventionell. Lobend erwähnt Kappert auch, dass politische Aushandlungsprozesse und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie thematisiert werden. Besonders positiv findet sie, dass Nyborg zum Schluss einen Weg für sich findet, Job und Liebe unter einen Hut zu bekommen – im Gegensatz zur sonst üblichen Darstellung von Karrierefrauen, die am Ende untergehen.
Auch für die Filmemacherin und Kulturwissenschaftlerin Christine Lang ist „Borgen“ ein Positiventwurf, „fast schon ein Märchen von Parteiendemokratie“. Dagegen entwickle die US-Serie „House of Cards“ ein sehr zynisches Politikerbild; hier gehe es vor allem um Intrigen und Gegenintrigen. Beide Serien, sagt Lang, haben ein reflexives Potential mit starker Betonung auf der Rolle der Medien und der Familie. Ansonsten hätten sie wenig miteinander zu tun: hier europäisches, dort amerikanisches Erzählen. In Europa stünden die Figuren immer im Kontext, in Amerika drehe sich alles um den Helden.
Sowohl Kappert als auch Lang beklagen, dass sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland nicht an kritische Polit-Serien herantraut. Schuld seien die Organisation der Sender, strukturelle Probleme wie Vertrags- und Produktionsbedingungen, aber auch die Tradition, dass es im deutschen Fernsehen eher Naturalismus als Fiktion gebe.
Weitere Video-Mitschnitte der Tagung finden Sie auf unserem Youtube-Kanal - weitere Fotos gibt's in unserem flickr-Album:





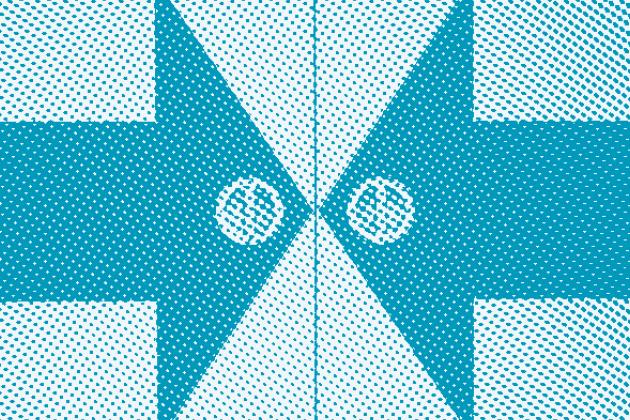


1 Kommentar
Neuen Kommentar schreiben
14. Februar 2017
Hendrik O.
Allen, die an der Zukunft der Demokratie interessiert sind, empfehle ich die "Revolution der Demokratie" von Johannes Heinrichs.
Das unsere aktuelle „Demokratie“ nicht perfekt ist, weiß oder spürt jeder. Der Autor nimmt sie aber in einer Art und Weise auseinander und entblößt ihre (strukturellen) Schwächen, dass einem Angst und Bange wird. Nebenbei rechnet er mit Kapitalismus, Neoliberalismus, Lobbyismus und EU ab.
Die Entwicklungsgeschichte und die Analyse der heutigen Demokratien in komprimierter Form öffnen einem in beeindruckender Weise die Augen.
Seine aus den menschlichen Reflexionsstufen hergeleitete „Revolution der Demokratie“, die Vierstufigkeit des Parlaments, klingt so einfach und wirkungsvoll, dass man gleich morgen damit beginnen will.
https://www.amazon.de/Revolution-Demokratie-Eine-konstruktive-Bewusstsei...